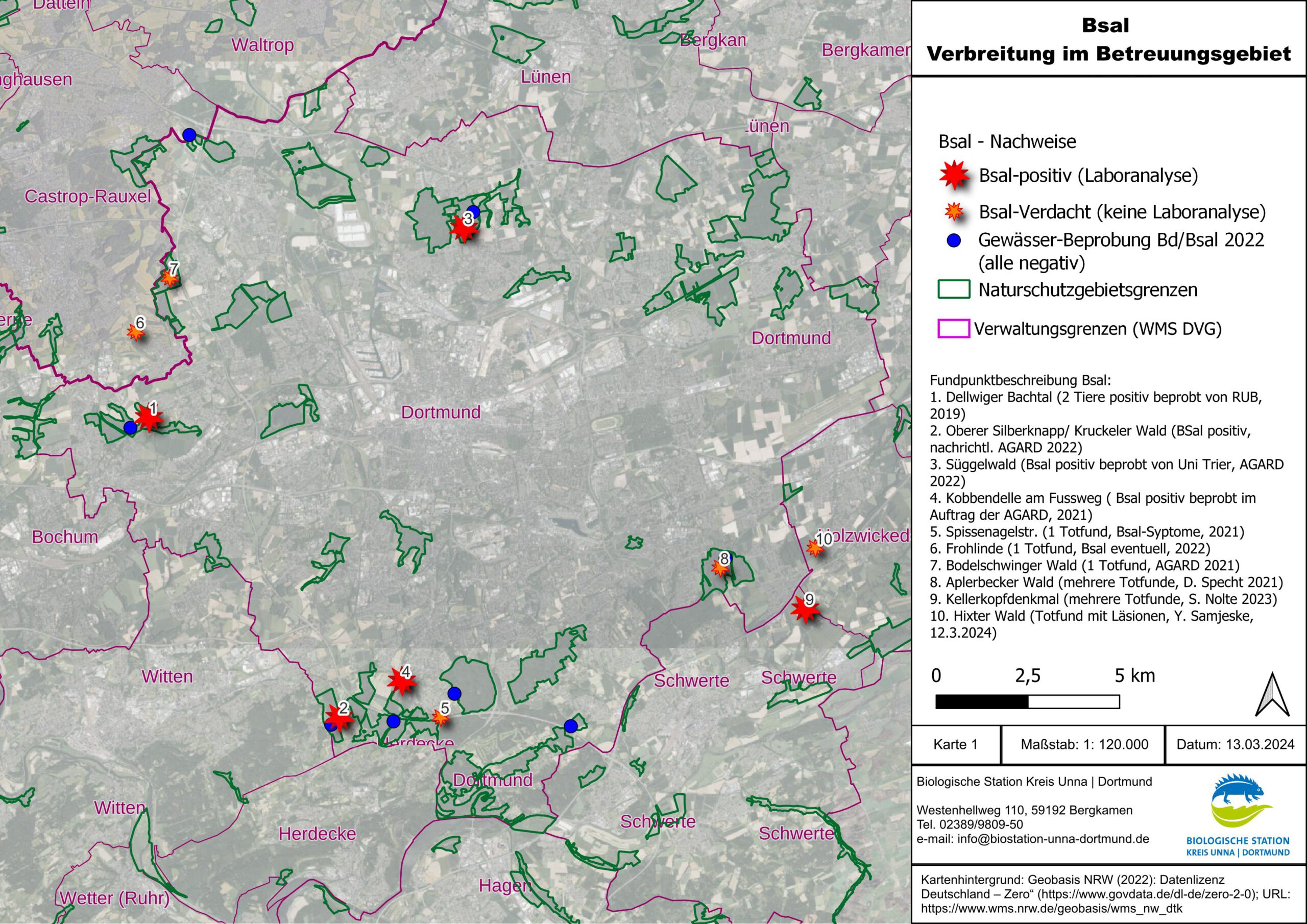Seit 2008 erfassen wir jährlich im Auftrag des Lippeverbandes an der Lippe zwischen Gersteinkraftwerk im Osten und Kreisgrenze Recklinghausen im Westen Eisvögel und Uferschwalben.Durch das Lippehochwasser im Winter 2023/24 (HQ25 im Dezember 2023) sind vielerorts neue Uferabbrüche entstanden oder alte reaktiviert worden.

Zahlreiche Steilwände wurden umgehend vom Eisvogel besiedelt. Mit stolzen 24 Brutpaaren haben wir beim Eisvogel den zweithöchsten Brutbesstand seit Beginn der Datenerfassung (Maximum 2015: 26 Brutpaare).

Die Brutbestände der Uferschwalbe liegen leider weiterhin auf niedrigem Niveau. An zwei Steilwänden (Segelflugplatz Lünen und östlich A1) wurden insgesamt 33 Brutpaare erfasst. Hoffnung auf einen perspektivisch Anstieg der Brutpaare machen Anfang Mai beobachtete Steilwandsondierungen von Uferschwalben, bei denen es allerdings (noch) nicht zu Brutansiedlungen kam.